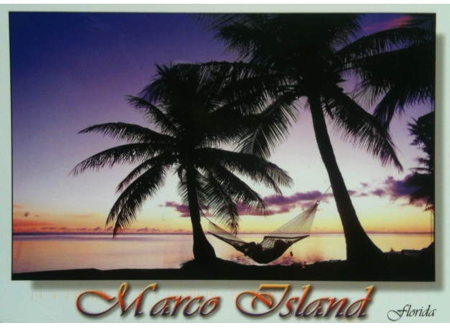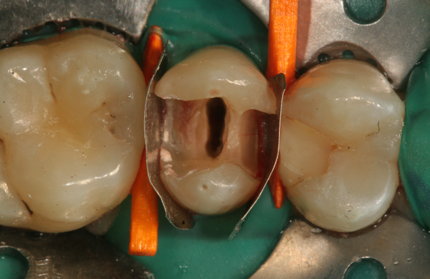Der folgende Beitrag ist ein Exzerpt des Beitrages „Zur Bau- und Arbeitsgeschichte der Weinbergskultur“ der Autoren Werner Konold, Claude Petit und Franz Höchtl aus der Zeitschrift Schwäbische Heimat, 2010/1.
Die Anfänge des Weinbaus in Württemberg dürften bis ins 7. und 8. Jahrhndert zurückreichen. Anhand von Schenkungsurkunden kann nachvollzogen werden, wie Rebflächen aus freiem oder privatem Eigentum an geistliche Grundherrschaften geschenkt wurde. Die Quellen schweigen jedoch darüber, ob es sich um Terassenweinberge handelte – technisch wäre dies ohne Zweifel möglich gewesen. Den Weinbauern dürfte aber nicht entgangen sein, dass nicht nur die Sonneneinstrahlung in den Hanglagen dem Wachstum der Reben dienlich ist, sondern auch der bessere Schutz vor Frost durch die abfliessende Kaltluft. Die Anfänge des Terassenbaus im Remstal werden auch mit dem Beginn des Burgenbaus um 1050 verbunden. Im 16. Jahrhundert werden Gesetze und Verordnung zum Weinbau erlassen, die das Ziel verfolgen, unkontrollierten Rebbau einzuschränken und Versorgungsprobleme durch den Wegfall von Wiesen, Weiden und Äckern vorzubeugen. So erlaubt beispielsweise die württembergische Landesverodnung von 1567 den Weinbau nur auf verwildertem, mit Dornbüschen oder Hecken bewachsenem Gelände.
Obwohl der Weinbau ab dem 18. Jahrhundert auch wissenschaftlich begleitet wurde, dürfte die Mehrzahl der Wengerter ohne Kenntnis von Fachliteratur in immer wiederkehrenden Arbeitsschritten ihre Weinberge bearbeitet haben. Neben der Pflege der Pflanzen galt die Aufmerksamkeit der Weinbauern dem Boden. Gedüngt wurde, wie in der Langwirtschaft üblich, mit organischen Stoffen wie etwa Mist oder Stroh. Weinbergspezifisch dürfte jedoch die folgende Tätigkeit gewesen sein: Regelmäßig mußte Erde in die Weinberge getragen werden, um den vom Regen abgeschwemmten Boden zu ersetzen. Das Durchmischen mit mineralhaltigen Mergeln aus weinbergsnahen Mergelgruben sorgte für eine mineralische Düngung der Reben.
Die Trockenmauern sind seit altersher Teil des Rebflächen. Die Erschließung der steilen Lagen erfolgt über Treppen und Staffeln von teilweise sehr unterschiedlicher Ausführung. So waren wohlhabende Besitzer in der Lage, begabte und gut bezahlte Feldmaurer zu beschäftigen, wodurch eine teilweise außergewöhnliche Qualität der Maueren erreicht werden konnte. Die Steine der Trockenmauren wurden meist direkt im Weinberg oder einer in unmittelbarer Nähe der Weinberge angelegten Abbaustellen entnommen, der wirtschaftliche Aufwand hierfür dürfte mitunter aber enorm gewesen sein. In Erwartung eines zu erwartenden langfristig hohen Ertrages scheute man die hohen Invesitionen nicht. Man geht davon aus, dass dem Bau der Anlagen eine übergeordnete Planung von Fachleuten zu Grunde lag, detailierte Quellen hierzu gibt es jedoch keine. An Hand von Aufstellungen zur Qualifizierung und Entlohnung von Handwerkern kann jedoch nachvollzogen werden, dass verschiedene Handwerker und Akkordarbeiter am Bau beteiligt waren.
Empfehlenswert: Rundgang Kulturhistorischer Weinlandschaft Geigersberg/Ochsenbach, Stromberg. Karte hier.